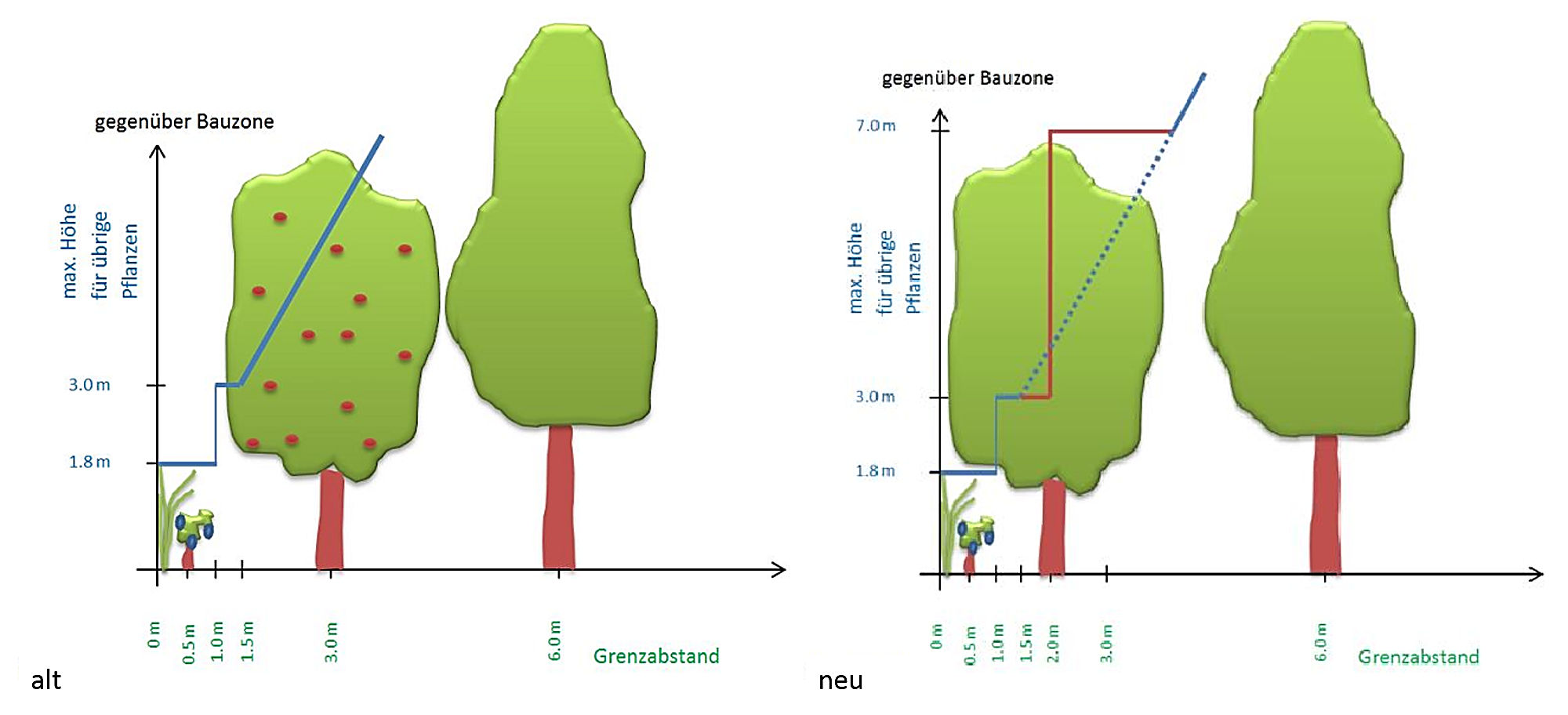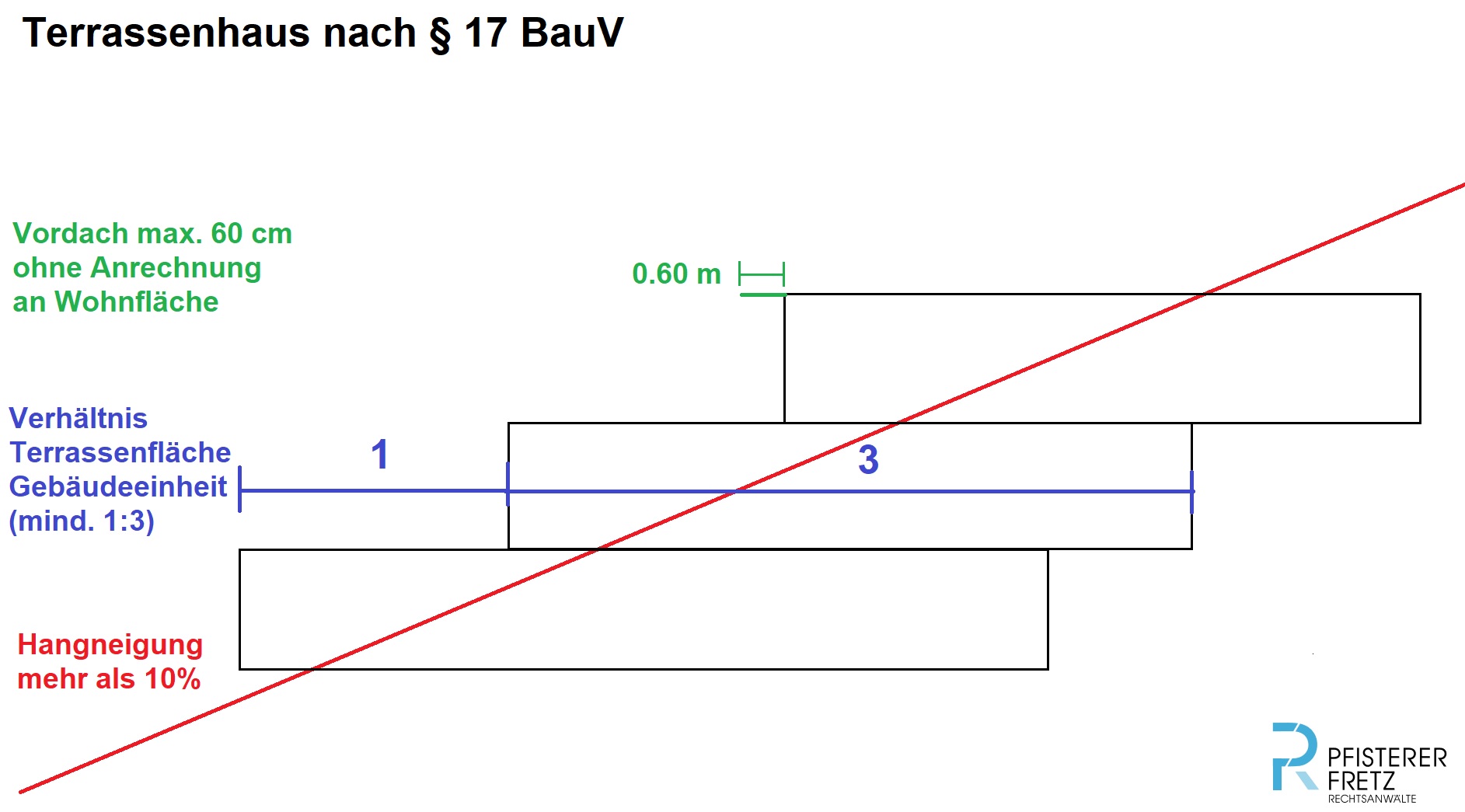/web/pfisterer.ch/media/newsletter/2017_September/1709_Elektroheizung_53077.jpg
3. Elektroheizungen: Als Hauptheizung nur ausnahmsweise erlaubt
Elektroheizungen haben in den vergangenen Jahrzehnten einen sonderbaren Wandel durchlaufen. In den 1970er und 1980er Jahren wurde diese Heizungsart speziell gefördert. Gebäudeeigentümer wurden teilweise sogar verpflichtet, Elektrospeicherheizungen einzubauen. Heute sind Elektroheizungen als Energieschleudern unerwünscht und je nach Einsatzbereich sogar verboten. Wir zeigen Ihnen auf, unter welchen Voraussetzungen Elektroheizungen noch zulässig sind.
Elektroheizungen werden je nach Einsatzgebiet als Speicherheizungen, Direktheizungen oder Infrarotstrahlen eingesetzt. Gebäude werden in aller Regel durch Elektrospeicherheizungen beheizt, welche Nachtstrom von Kernkraftwerken speichern und durch ein Wassersystem die Wärme verteilen oder mit elektrischen Drähten im Fussboden, Sitzbänken oder Elektroheizkörper die Räume aufwärmen. Elektroheizungen geniessen einen schlechten Ruf und sind heute in vielen Kantonen verboten.
Im Kanton Aargau beispielsweise bestimmt § 7 Abs. 2 des Energiegesetzes (EnergieG), dass "neue ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen" zur Gebäudebeheizung nicht zulässig sind. Nicht nur neue Elektroheizungen sind grundsätzlich verboten, sondern auch der Ersatz einer elektrischen Widerstandsheizung durch eine gleichartige Heizungsanlage ist nicht zulässig. Das Verbot betrifft nach § 7 Abs. 3 EnergieG jedoch nur Heizungsanlagen in Gebäuden, die bereits über ein Wasserverteilsystem verfügen.
Die Energieverordnung (EnergieV) des Kantons Aargau kennt einige Ausnahmen von diesem Verbot. Laut § 24 Abs. 1 EnergieV dürfen herkömmliche ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen als (1.) Notheizung bei Aussentemperaturen unter der Auslegungstemperatur der Hauptheizung eingesetzt werden. Sie dürfen auch (2.) zusätzlich zu (handbeschickten) Stückholzheizungen zur Deckung eines Leistungsbedarfs bis 50 % der Heizleistung installiert werden. Ebenfalls zulässig sind Elektroheizungen als Komfortheizungen für eng begrenzte Heizzwecke. Dazu gehören beispielsweise Handtuchradiatoren oder Heizstrahler in Badezimmern oder in einzelnen Kellerräumen bestehender Gebäude. Elektrische Widerstandsheizungen als Hauptheizung sind in der Regel nicht zulässig, da sie unter keine der genannten Ausnahmen fallen.
Stossend kann das Verbot von Elektroheizungen beim Ersatz einer in die Jahre gekommenen Hauptheizung sein. Ist im Gebäude noch kein Wasserverteilsystem installiert, so sind die mit dem Umstieg auf eine Wärmepumpe verbundenen Investitionskosten sehr hoch. Es wäre unverhältnismässig, in diesem Fällen den Einbau einer energieeffizienteren Anlage zu verlangen. Fehlt ein Wasserverteilsystem, dürfen bestehende ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen daher grundsätzlich ersetzt werden (§ 7 Abs. 3 EnergieG e contrario).
Verfügt das Gebäude über ein Wasserverteilsystem, dürfen die Behörden den Ersatz durch eine gleichartige Heizungsanlage verbieten, es sei denn, der Einbau einer energieeffizienteren Anlage sei "wirtschaftlich nicht tragbar" (§ 7 Abs. 3 EnergieG, 2. Satz). Gerade diese Ausnahmebestimmung ist in der Praxis häufig umstritten. Ein wichtiger Aspekt dieser Verhältnismässigkeitsprüfung ist die gesetzgeberische Absicht, dass zur Beurteilung der wirtschaftlichen Tragbarkeit die Investitions- und Betriebskosten über die Lebensdauer einer Baute oder Anlage einbezogen werden müssen (Botschaft*, S. 12). Die oft höheren Investitionskosten für energieeffiziente Wärmeerzeugungsanlagen werden den reduzierten Betriebskosten über die ganze Lebensdauer der Anlage gegenübergestellt. Der Regierungsrat geht in seiner Botschaft davon aus, dass sich die Investitionen in die Energieeffizienz für die Eigentümerinnen und Eigentümer der Anlagen aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerung für Energie bereits auf mittlere Sicht hinaus lohnen (Botschaft*, S. 16).
Will ein Grundeigentümer seine bestehende Elektroheizung durch eine neue ersetzen und verfügt er bereits über ein Wasserverteilsystem, so hat er geltend zu machen, dass die Neuinstallierung einer energieeffizienteren Wärmeerzeugungsanlage wirtschaftlich nicht tragbar sei, da sie im Vergleich zu einem Eins-zu-eins-Ersatz – auch unter Berücksichtigung der tieferen Betriebskosten über die ganze Lebensdauer der Anlage – unverhältnismässig teurer sei. Es dürfte relativ schwierig sein, den Nachweis zu erbringen, dass die Installation einer Wärmepumpe wirtschaftlich nicht tragbar sei, da der kostenmässige Aufwand insgesamt wesentlich höher ausfällt. Der Ersatz durch neue elektrische Widerstandsheizung bei bestehendem Wasserverteilsystem erweist sich daher in den meisten Fällen als unzulässig.
Fazit: Neue Elektroheizungen als Hauptheizungen sind nicht mehr zugelassen. Ist noch kein Wasserverteilsystem vorhanden, so ist der Ersatz einer bestehenden elektrischen Widerstandsheizung durch eine neue grundsätzlich möglich. Besteht bereits ein Wasserverteilsystem, ist der Ersatz durch eine neue elektrische Widerstandsheizung nur zulässig, wenn die wirtschaftliche Tragbarkeit nicht gegeben ist. Dieser (schwierige) Nachweis ist durch die Grundeigentümer zu erbringen.
*Botschaft des Regierungsrats des Kantons AG an den Grossen Rat vom 9. Juni 2010 zur Totalrevision des Energiegesetzes des Kantons Aargau (EnergieG); Bericht und Entwurf zur 1. Beratung
Hier zum Bericht